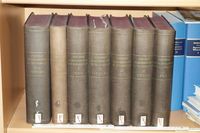Wissenschaftliches
Privat dürfen Sie die Inhalte dieser Homepage gerne verwenden. Wenn Sie sie aber für wissenschaftliche oder kommerzielle Zwecke verwenden wollen, dann nehmen Sie bitte vorher mit mir Kontakt auf über "schwaebisch@posteo". Herzlichen Dank! |
1. Im Alltagsgespräch gehörtes Schwäbisch ist authentisch.
Ich nehme nur solche Formulierungen auf, die ich in einem Alltagsgespräch unter alteingesessenen Schwaben beiläufig mitgehört habe und nicht erfragt habe. Dieses beiläufig mitgehörte Alltagsschwäbisch ist authentisch. Hier lassen sich Aussprache, Wortschatz und Grammatik klar erkennen.
Nicht authentisch ist vieles, was in der Juxliteratur als angebliches Schwäbisch ausgegeben wird. Da ist viel künstlicher Blödsinn mit dabei, der im tatsächlichen Sprachalltag nirgends vorkommt. Ich verzichte darauf, die Namen dieser Autoren zu nennen. Auch ihre Schreibung ist meist eine Katastrofe. So ist es fast die Regel, dass ein und dasselbe Wort nur eine Seite später anders geschrieben wird. Lesen diese Autoren ihre Werke vor dem Druck eigentlich noch mal selbstkritisch durch?
2. Gezielt abgefragtes Schwäbisch ist nur bedingt tauglich.
Gezielt erfragtes Schwäbisch weicht oft von dem im Alltag gesprochenen Schwäbisch ab und zeigt hochdeutschen Einfluss. Warum? Werden Schwaben direkt befragt, antworten sie in der Regel in einer Art Mikrofonschwäbisch. Sie neigen unbewusst dazu, eine solche Sprachebene zu wählen, die sich dem/der auf hochdeutsch Fragenden ein Stück weit annähert.
In der Physik ist dies als Subjekt-Objekt-Problem bekannt. Die fragende Subjektsperson hat mit ihrer Sprachebene ungewollt Auswirkungen auf die Antworten der befragten Objektsperson. Ein Beispiel: Der Befragte hat zunächst mit "mir hend" erzählt. Nach einer Zwischenfrage des Interviewers fährt er mit "mir habet" fort. Warum? Weil der Interviewer auf Hochdeutsch zwischengefragt hat: "Wie haben Sie ...?"
Insbesondere auch kommunale Angestellte neigen zu Mikrofonschwäbisch, wenn man sie über die örtliche Mundart befragt. In meiner Forschungsarbeit haben sich deren Auskünfte sehr oft als fehlerhaft herausgestellt. Denn der beiläufig mitgehörten tatsächliche Sprachgebrauch ihrer alteingesessenen schwäbischen Bürger/innen auf der Straße oder unter Verwandten ergab ein anderes Bild.
3. Die klassische schwäbische Mundartliteratur wird herangezogen.
Ich nehme bewusst Bezug auf solche Autoren, die sich eine durchdachte Darstellung ihrer Mundart zum Ziel gesetzt haben. Zu den Autoren, die ihre Darstellung der Mundart durchdacht haben, gehören zum Beispiel Michael Buck, Karl Hötzer, Fritz Holder, Matthias Koch, August Lämmle, Wilhelm König, Rudolf Paul, Friedrich E. Vogt, Carl und Richard Weitbrecht.
Die meisten dieser Autoren geben zudem an, wie sich bei ihnen Aussprache und Verschriftlichung zueinander verhalten. Derartige Hinweise sind ein Kennzeichen gut reflektierter Autorenschaft.
Das 7-bändige Schwäbische Wörterbuch von Hermann Fischer dient in allen Zweifelsfällen als kritischer Prüfstein für die Frage, was genuines Schwäbisch ist. Es steht in meinem Bücherregal.
Beachtet werden muss aber: Fischer stellt alle Sprachregionen des ehemaligen Königreichs Württemberg dar. Sein Wörterbuch enthält deshalb nicht nur Schwäbisch, sondern auch Fränkisch.
Er listet seine Belege nach Oberämtern auf. Da er seine Aufstellungen von Norden nach Süden ordnet, stehen die Wortformen aus den württembergisch-fränkischen (!) Oberämtern am Anfang; danach erst folgen die Wortformen aus den württembergisch-schwäbischen Oberämtern. Diejenigen Wortformen, die aus den fränkischen Oberämtern Württembergs stammen, müssen aber fürs Schwäbische außen vor bleiben!
4. Die schwäbische Sprache wird vom Alt- und Mitteloberdeutschen hergeleitet
Die schwäbische Sprache ist kein (!) degeneriertes Hochdeutsch. Jedweder Vergleich des Schwäbischen mit dem Hochdeutschen nach dem Motto: "Was hat das Schwäbische am Hochdeutschen verändert?" ist wissenschaftlicher barer Unsinn. Das heutige Hochschwäbische war spätestens um 1450 n. Chr. weitgehend ausgeformt. Dagegen ist das Hochdeutsche in seiner heutigen Form erst ab 1650 n. Chr. festgelegt worden.
Die schwäbische Sprache ist, ebenso wie das Bairisch-Österreichische und das Alemannische, eine Weiterentwicklung ihrer gemeinsamen Vorgängersprache Altoberdeutsch (ca. 750 - 1050 n. Chr.). Ausformung, Wortlaut und Grammatik des heutigen Schwäbischen wird mit dieser Vorgängersprache in Beziehung gesetzt.
Das heutige so genannte Neuhochdeutsche dagegen ist eine Weiterentwicklung der Vorgängersprache Altmitteldeutsch (ca. 750 - 1050 n. Chr.). Die grammatikalischen, lexikalischen und phonetischen Unterschiede zwischen den mitteldeutschen und den oberdeutschen Sprachen sind massiv und werden vom Duden konsequent ignoriert.
Für den Abgleich des Schwäbischen mit der Nachbarsprache Alemannisch konsultiere ich die "Alemannische Grammatik" von Karl Weinhold. Für den Abgleich mit der Nachbarsprache Bairisch-Österreichisch konsultiere ich das "Bairische Wörterbuch" Johann Jakob Schmellers und die "Bairische Grammatik" Karl Weinholds.
1125